
Willkommen zu dieser Secret Podcast Folge.
Du kannst die Folge direkt hier hören. Du musst dir kein Soundcloud Konto machen.
Klicke auf "Listen in Browser" 👇
Die Supermom – eine Erfindung mit Folgen
Es gibt ein Thema, das mich immer wieder umtreibt. Und deshalb möchte ich in der heutigen Podcastfolge genau darüber sprechen.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich Nachrichten von Frauen nach der Geburt bekomme mit:
- "Bin ich normal?"
- "Ich müsste doch viel mehr Leistung bringen können"
- "Ich schaff das nicht"
- "Aber alle anderen machen das doch auch mit links"
- "Was ist los mit mir?"
- "Wieso fühle ich mich so falsch, so schuldig, so faul, so müde?"
Wenn du diese Gedanken kennst, bist du nicht allein.
Und nein, heute geht es nicht um Hormone und was die alles mit uns anstellen. Hör dir dazu gerne Podcastfolge #28 an.
Heute geht es mir um ein Gesellschafts-Ideal, das Frauen reihenweise ins Burnout treibt.
In Erschöpfung, Überforderung und Schuldgefühle.
Nicht nur in den ersten Wochen nach der Geburt – sondern ein Leben lang.
Aber – und das ist wichtig – das ist ein Problem, das absolut nicht bei dir liegt.
Es liegt in einem Ideal, das so tief in uns verankert ist, dass wir oft gar nicht merken, wie sehr es unser Leben bestimmt.
Das zieht sich das gesamte Mutterleben lang durch.
Und auch ohne Kinder zu haben, tragen die meisten Frauen das mit sich herum.
Viele kinderlose Frauen tragen zusätzlich noch ein Schuldgefühl in sich, dass sie ihren biologischen Sinn nicht erfüllt haben. Das ist nicht unbedingt bewusst, aber viele suchen den Fehler bei sich, wenn sie es "nicht geschafft" haben, Kinder zu bekommen. Und ich meine jetzt nicht die emotionale Seite, wenn eine Familie fehlt im Leben, wenn man sich eine Familie gewünscht hat. Was ich meine, ist noch mal eine andere Ebene. Dazu gleich mehr.
Heute geht es um:
Die Supermom!
Und ihre Cousinen Superwoman und Wonderwoman.
Ein Idealbild, das so tut, als wäre es eine persönliche Stärke, keine Schwäche zu zeigen, immer zu funktionieren und niemals Hilfe zu brauchen.
Ein Konstrukt – geboren aus kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Interessen.
Ein Produkt von Systemen, die profitieren, wenn Frauen alles geben – und nichts fordern.
Das Tragische:
Viele, viele, viele Frauen versuchen, diesem Bild gerecht zu werden.
Einem Bild, das nie echt war.
Und weil es so allgegenwärtig ist, stellen wir es kaum noch in Frage.
Die Supermom war nie real. Doch sie ist so lebendig wie nie zuvor.
Sie hat uns alle geprägt.
Und vielleicht kennst du sie:
Die Stimme, die dir leise zuflüstert, dass du alles schaffen musst.
Am besten noch gleichzeitig. Und alleine.
Kinder, Karriere, Partnerschaft, Haushalt – und dabei bitte noch gelassen, sportlich, liebevoll, gepflegt, reflektiert, flexibel, erfolgreich.
Ein ganzes Leben im Hochleistungsmodus – mit Lächeln.
Keine Schwäche zeigen.
Das ist deine Supermom, die sich verselbstständigt.
Oder deine Wonderwoman, die denkt Perfektionismus ist ein Auszeichnungsmerkmal.
Aber:
Diese Figur ist kein Naturgesetz.
Sie ist gemacht.
Sie ist kein natürliches Lebewesen.
Sie ist eine Erfindung.
Seit Generationen wird uns dieses Ideal vorgegaukelt und eingetrichtert.
Und wir … wir fallen ihm anheim – und wundern uns, warum wir so ausgelaugt sind.
Wir merken es kaum noch.
Bis wir es dann merken, weil wir nicht mehr können.
Ich nenne das das "Supermom-Syndrom" (Oder eben auch das Superwoman-Syndrom).
Der Einfachheit halber und weil es mir hier in erster Linie um Mütter geht, bleibe ich bei dem Wort Supermom.
Es klingt ja fast schmeichelhaft – schließlich steckt "super“ drin.
Doch in Wahrheit ist das ein Trugbild, das Frauen systematisch ausbrennt.
Körperlich. Emotional. Und strukturell.
📌 Was ist das Supermom-Syndrom?
Der Begriff beschreibt den inneren und äußeren Druck, den viele Mütter empfinden, nach der Geburt alles richtig und am besten allein zu
machen.
Es ist natürlich kein offiziell diagnostiziertes Syndrom – aber ein weit verbreitetes gesellschaftliches Phänomen bzw. Problem.
Typische Merkmale:
-
Ständiges "Ich schaff das schon“ trotz Überlastung
-
Schuldgefühle, wenn Hilfe angenommen oder eingefordert wird
-
Vergleich mit anderen Müttern (v.a. über Social Media)
-
Permanente körperliche Selbstoptimierung (z. B. "schnell wieder in Form kommen“, sich schämen, wenn man nicht "den" Body hat)
- Mentale Selbstoptimierung ("Ich muss nur mein Mindset ändern“ ) dazu komme ich gleich noch. Das hat einen eigenen Abschnitt verdient.
-
Keine echten Pausen oder Erholung, sondern nur To-Do-Listen
Mir ist es wirklich wichtig, dass wir verstehen:
- Woher dieses Ideal wirklich kommt
- Warum es so schwer ist, sich davon zu lösen
- Und was wir tun können, um es endlich zu durchbrechen – statt es weiter zu normalisieren.
Damit sich keine Frau mehr ständig fragen muss:
Warum bin ich so falsch?
Was stimmt mit mir nicht, dass ich das nicht alles alleine schaffe?
Was muss ich noch tun, um noch "besser" zu werden?
Und damit Pausen und Regeneration endlich ins normale Leben integriert werden, bevor jemand krank wird, Herzinfarkte oder Krebs bekommt. (Unser Gesundheitssystem ist kein Präventionssystem. Da wird nur eingegriffen, wenn es fast schon zu spät ist und eben im Krankheitsfall. Da gilt meistens "geht doch noch", auch wenn die Werte unterirdisch sind, Eisen zum Beispiel oder Vitamin D. Da werden ältere Frauen nicht regelmäßig darauf hin untersucht, ob sich vielleicht bei einem Mangel Osteoporose entwickeln kann. Wenn man das nicht selbst auf dem Schirm hat, kannst du das vergessen. Reihenweise werden die älteren Leute an der Wirbelsäule operiert, weil die Wirbel gerne mal einbrechen. Als ob das am Ende Kosten erspart. Das hab ich dieses Jahr live bei meiner Mutter erlebt. Ganz fürchterliche Versorgung vorher, währenddessen und danach).
Wichtig: Dieses Ideal ist real, das gibt es sehr präsent, aber es ist keine Realität.
Es ist ein Konstrukt – geformt aus kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Interessen.
Bikini, Babybauch, Beckenboden?
Hol dir 10 Impulse für Body Positivity & Selbstvertrauen – ganz ohne Selbstoptimierungsstress nach der Geburt.
Lies auch gerne den dazu gehörigen Blog Artikel.
Mein kostenloses PDF für mehr Verbundenheit mit deinem Körper nach der Geburt.
Historische Wurzeln: Wie die Supermom entstand
Um zu verstehen, warum die Supermom so hartnäckig ist, müssen wir ein bißchen in der Geschichte zurückgehen – aber nicht nur ein paar Jahrzehnte, sondern tief in die Geschichte der Frauenrechte.
Ich will jetzt nicht bei der Hexenverbrennung und dem kollektiven Unbewussten anfangen, aber die letzten 100 Jahre waren insgesamt extrem prägend.
Vor dieser Zeit, also vor ungefähr 100-120 Jahren, gab es im Prinzip überhaupt keine Frauenrechte.
Die erste Welle der Frauenbewegung in Deutschland fällt grob in die Zeit vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ende der Weimarer Republik. Sprich bis 1933.
Das mag dir vielleicht ein bißchen zu lang her erscheinen, doch warte und bleib bis zum Ende.
Sie kämpfte um Grundrechte:
- Zugang zu Bildung
- Recht auf Arbeit
- Recht auf Eigentum
- Wahlrecht
Ende 19. Jahrhundert:
- Sind Frauenvereine entstanden (Bildung, soziale Arbeit, später auch politische Rechte).
- Fokus: Zugang zu höherer Bildung, Berufen, politischer Mitbestimmung.
1908:
- Frauen dürfen erstmals Mitglied in politischen Parteien werden.
Zwischen Bildungskampf und Fabrikalltag
Ende des 19. Jahrhunderts zeigte sich bereits eine Spaltung: Während bürgerliche Frauen für den Zugang zu höherer Bildung und akademischen Berufen kämpften, standen Millionen Arbeiterinnen in Fabriken, in der Landwirtschaft oder als Dienstmädchen im Dauereinsatz. 12-Stunden-Tage, Hungerlohn und Verantwortung für Kinder und Haushalt ließen kaum Raum für politische Organisierung.
Die Frauenbewegung dieser Zeit war also kein einheitliches Projekt, sondern zwei Welten:
Hier die "Neue Frau“ im Kampf um Universitäten, dort die Arbeiterin, deren tägliche Realität von Ausbeutung und Armut geprägt war.
Und genau darin liegt auch eine historische Kontinuität: Wer am Limit ist, hat keine Kraft für Revolution.
Diese Brüche zwischen Klassen- und Frauenfrage begleiteten auch die Weimarer Republik – und machten es den reaktionären Kräften später leichter, die Errungenschaften wieder zurückzudrängen.
Es gab Gott sei Dank auch einige politisch aktivere Arbeiterinnen, die für soziale Gerechtigkeit gekämpft haben, aber das wurde in der NS Zeit direkt wieder zu nichte gemacht.
Der Erste Weltkrieg veränderte das Leben der Frauen in Deutschland grundlegend.
Während die Männer an der Front waren, übernahmen sie oft deren Aufgaben – in Betrieben, Verwaltungen, auf den Feldern und in der Organisation des Alltags.
Viele Männer kehrten nach Kriegsende nicht zurück, andere kamen körperlich oder seelisch schwer gezeichnet nach Hause – und trafen auf Frauen, die seit Jahren eigenständig für Familie, Haushalt und wirtschaftliches Überleben gesorgt hatten.
Diese Erfahrung brachte vielen Frauen ein neues Selbstbewusstsein – auch in Fragen von Partnerschaft und Sexualität.
Vor allem in den Großstädten veränderte sich die Moral: Mehr Offenheit, mehr Freiheit, mehr Gestaltungsspielraum für das eigene Leben.
Zu Beginn der Weimarer Republik , also vor dem 2. Weltkrieg, stieg die Scheidungsrate spürbar an – nicht nur bei hastig im Krieg geschlossenen Ehen, sondern auch bei langjährigen Verbindungen.
Mit der Weimarer Republik begann für viele Frauen eine Zeit neuer Möglichkeiten – zumindest in den Städten.
Das Wahlrecht, der Zugang zu höheren Bildungswegen und in manchen Fällen auch zu akademischen Berufen eröffneten Perspektiven, die noch wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen waren.
Das Bild der "Neuen Frau“ prägte diese Ära: Selbstständig, berufstätig, modisch, oft mit kurzem Bubikopf, und mit einem deutlich freieren Lebensstil als die Generation vor ihr.
Dieser Aufbruch war zwar nicht flächendeckend. Auf dem Land und in traditionell geprägten Kreisen blieb das Leben vieler Frauen weitgehend unverändert – harte Arbeit, wenig Rechte, gesellschaftliche Kontrolle. Trotzdem war der Wandel spürbar, und er war bedeutsam: Frauen hatten erstmals in größerem Maßstab die Chance, ihr Leben eigenständiger zu gestalten.
1918/19 (Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg):
- 1918: Frauen erhalten das aktive und passive Wahlrecht.
- 1919: 37 Frauen ziehen ins erste Reichsparlament ein.
- Erste Politikerinnen und Juristinnen treten öffentlich in Erscheinung.
Weimarer Jahre:
- Mehr Frauen in höheren Berufen, es gibt eine etwas größere soziale und kulturelle Freiheit.
- Dennoch: Doppelbelastung & gesellschaftliche Widerstände bleiben stark.
In der Weimarer Republik nach dem 1. Weltkrieg gab es enorme Fortschritte: Wahlrecht, Bildung, berufliche Öffnung, gesellschaftliche Sichtbarkeit von Frauen.
ABER: All das sollte nur wenige Jahre später ein jähes Ende finden.
Mutterschaft als politische Mission
1933: Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde diese fortschrittliche Entwicklung abrupt gestoppt.
Innerhalb kürzester Zeit wurde alles zurückgedreht.
- Frauen wurden aus öffentlichen Ämtern entfernt,
- aus vielen Berufen gedrängt,
- politische Organisationen wurden verboten,
- das Frauenbild radikal auf "Kinder, Küche, Kirche" reduziert und
- sie wurden in ihrer Freiheit massiv eingeschränkt.
Das geschah nicht nur durch Gesetze, sondern auch durch eine gezielte, aber rasch wirkende Normalisierung eines rückwärtsgewandten Frauenbildes. Viel von dem, was in der Weimarer Republik erkämpft wurde, war so innerhalb weniger Monate wieder verloren.
So, und das was jetzt kommt, ist super wichtig!
Weil wir auch ganz aktuell politische Strömungen sehen, die sehr erfolgreich sind und die daran arbeiten, uns wieder 100 Jahre zurück zu versetzen.
Also, vergessen wir nicht das Folgende:
Im NS-Staat wurde das Bild der Frau stark ideologisiert, aber auf gar keinen Fall zu ihren eigenen, individuellen Gunsten:
Frauen sollten vorrangig als Mütter agieren, charakterisiert durch Hingabe, Treue und Opferbereitschaft – stets dem Wohl der "Volksgemeinschaft“ verpflichtet. Die Rolle als Mutter galt als nationale Aufgabe, nicht als individuelle Entscheidung.
Staatlich wurden Mutterschaft und viele Kinder gezielt gefördert, etwa durch das Mutterkreuz, verliehen an gebärfreudige Frauen, zugleich ein Symbol für “Volksdienst”.
Auch der Muttertag wurde offiziell zum Feiertag gemacht – als Teil der nationalen Mobilisierung.
Bildungseinrichtungen wie die sogenannten Mütterschulen oder Reichsmütterschulen (z. B. in Wedding) bildeten Frauen gezielt zu Haushalt, Kinderpflege, Ideologievermittlung und "Volksgemeinschaftstreue“ aus.
Hausgeburt und Rückbildung als politische Tools
Die Hausgeburt als nationales Ideal.
Die Hausgeburt wurde propagandistisch verklärt — sie galt als "heroisch“, weil sie den Zusammenhalt in der Familie stärken und Mutterschaft im privaten Rahmen zelebrieren würde.
Gleichzeitig war sie ein Kostenersparnis im öffentlichen Gesundheitssystem und vor allem im Krieg wichtig.
Unter der Leitung von Nanna Conti, Reichshebammenführerin im Nationalsozialismus, wurde ein neues Hebammengesetz eingeführt (1939), das Heimgeburt und Hebammenbeauftragung zur Pflicht machte. Hebammen wurden streng kontrolliert und mussten rassistische Kriterien berücksichtigen.
Krankenhausgeburten waren zwar erlaubt, wurden aber nur bei medizinischer Indikation empfohlen.
Für gesunde Frauen galt die Hausgeburt als "Normalfall“ und wurde propagandistisch verherrlicht.
Was damals als Fürsorge für Mütter verkauft wurde, war Teil eines rassistischen, autoritären Staates, der Frauen instrumentalisiert hat.
Die staatliche "Fürsorge“ für Mütter – etwa über Hebammen, Hausgeburten und Wochenbettpflege – war nicht als individuelle Unterstützung gedacht, sondern als Teil einer nationalistischen Bevölkerungspolitik und sie war ideologisch auf das "arische Mutterbild“ zugeschnitten.
Geburt, Rückbildung und Wochenbett wurden zwar "aufgewertet“, aber nur im Sinne einer politischen Funktion: Gesunde, gebärfreudige "arische“ Mütter produzieren Nachwuchs für den Staat.
Das Hebammenwesen wurde zentralisiert, die Hausgeburt propagiert, Fürsorge im Wochenbett war nicht Selbstfürsorge, sondern Staatsauftrag.
Im Nationalsozialismus gab es tatsächlich Strukturen, die wie "Fürsorge“ für Mütter aussahen – in Wirklichkeit waren sie ein Instrument der Bevölkerungs- und Rassenpolitik.
Ab 1939 war es Pflicht, eine Hebamme bei jeder Geburt dabei zu haben – egal ob Haus- oder Klinikgeburt.
Hebammen waren staatlich organisiert, meldeten alle Geburten, führten Statistiken und mussten rassische Kriterien berücksichtigen (nur "arische“ Mütter bekamen volle Unterstützung).
Propagandistisch verklärt: Die "natürliche Hausgeburt“ im Kreis der Familie galt als besonders "volksverbunden“.
Die Hebammen berichteten direkt an Gesundheitsämter, meldeten Erbkrankheiten oder Missbildungen, damit daraufhin die Kinder abgeholt wurden, um sie "einer erfolgsversprechenden Behandlung" zu unterziehen, sprich sie wurden abtransportiert, um sie töten zu lassen.
Nach der Geburt kamen Hebammen mehrere Tage ins Haus, um Mutter und Kind zu versorgen – aber mit dem Ziel, die Mutter schnell wieder "funktionsfähig“ zu machen und den Nachwuchs im Sinne der Ideologie zu prägen und Soldaten zu erziehen für das Vaterland.
Ratschläge zu Erziehung, Ernährung und Körperpflege waren politisch gefärbt.
Schwangere und frischgebackene Mütter wurden in Reichsmütterschulen geschult: Haushalt, Hygiene, Kinderpflege, "rassische Erziehung“.
Diese Kurse hatten einen klaren Indoktrinationsauftrag.
Staatliche Hilfen (z. B. Kleiderpakete, Lebensmittelkarten) gab es vor allem für kinderreiche "arische“ Familien.
Nicht-arische Mütter, Zwangsarbeiterinnen oder politisch "unerwünschte“ Frauen bekamen kaum oder gar keine Unterstützung – teils sogar Zwangsabtreibungen.
Ja, es gab Hebammenbesuche, Wochenbettpflege und materielle Hilfe – aber:
Nur für ausgewählte Mütter, die ins rassistische Ideal passten.
Die Betreuung diente nicht der Selbstbestimmung, sondern der Kontrolle und ideologischen Erziehung.
Der "Fürsorge“-Begriff war damit im Kern schon instrumentalisiert.
Nur kurz nebenbeI: Wir leben jetzt, fast 100 Jahre später, mit Rechten, die selbstverständlich wirken, die aber noch überhaupt nicht alt sind.
Aber: Rechte können wieder verschwinden, wenn gesellschaftliche Strömungen größer werden, die Frauen primär in traditionelle Rollen zurückdrängen wollen.
Parteien wie die AfD formuliert in ihrem Programm ein Frauenbild, das direkt an vergangene autoritäre Zeiten erinnert: Die Frau als Mutter und Hausfrau, als Stütze einer "klassischen Familie“.
Moderne Familienformen? Unerwünscht.
Diversity? Ein Störfaktor.
Fortschritt ist nicht automatisch sicher.
Wir können und müssen Fürsorge für Mütter fördern, aber ohne sie in ein ideologisches Korsett zu pressen.
Die Geschichte lehrt: Wer schweigt, wenn Rollenbilder enger werden, wacht irgendwann in einer Realität auf, in der Wahlfreiheit keine Option mehr ist.
Und, wenn der Begriff "Frau" oder "Woman", wie in den USA in öffentlichen Dokumenten und Einrichtungen nicht mehr benutzt werden darf, ist das der Anfang einer voll beabsichtigten "Unsichbarmachung". Schnell kann's gehen.
In Großbritannien gibt es eine Bewegung, dass im Gesundheitswesen "Mother" ersetzt wird mit "Parent" (also Eltern) und Breast Feeding (Stillen = Brust Füttern) mit Chest Feeding (Brustkorb Füttern).
So etwas führt nicht zwangsweise zu besseren Verhältnissen in der Fürsorge für Frauen und Mütter, wenn nicht mehr unterschieden wird, um wen es sich handelt. Das haben wir in unserer patriarchalen Medizin schon genug. Ich finde, das ist nicht inklusiv, das ist destruktiv für die Frauengesundheit, die ganz besonders nach der Geburt, ganz spezielle Anforderungen hat, von denen immer noch viel zu wenig Menschen überhaupt sprechen oder auch überhaupt Ahnung haben, einfach, weil es im öffentlichen Konsens und in der Forschung nicht wichtig genug ist.
Frauen, die geboren haben, dürfen bitte auch so benannt werden! Und Brüste sind nun mal Brüste.
Und bei aller woke und gender Liebe, auch ich will als Frau nicht unsichtbar gemacht werden und aus dem öffentlichen Konsens verschwinden. Das bringt rein gar nichts, um die Frauenmedizin zu verbessern.
Aber wer weiß, ob das gerade vielleicht genau nicht die Absicht ist. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die es betrifft, die inkludiert werden sollen, das so nicht beabsichtigen, dass dafür die Frauen verschwinden. Das ist doch auch wieder nur künstlich konstruiert.
(Schau dir unbedingt die Serien "Babylon Berlin" an, wenn du ein bißchen einen Einblick in die Stimmung dieser Zeit haben möchtest und schau dir "The Handmaid's Tale" an. Das ist die krasseste Serie überhaupt, wenn es um die Entmenschlichung und Unterdrückung von Frauen geht. Und das ist im aktuellen Weltgeschehen so aktuell wie nie).
Die 50er und 60er
Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges brach das staatlich verordnete Geburts- und Fürsorgesystem zusammen.
Doch die Rollenbilder, die es geprägt hatte, sind nicht einfach so verschwunden – sie hatten sich tief ins gesellschaftliche Selbstverständnis eingegraben.
Die Nachkriegsjahrzehnte haben ein Erbe hinterlassen, das wir bis heute spüren.
Im Westen hat das Bild der hingebungsvollen Hausfrau und Mutter ganze Generationen geprägt – im Osten das Ideal der Mutter, die selbstverständlich alles unter einen Hut bringt: Haushalt, Kinder, Beruf.
In Westdeutschland:
- Der gesellschaftliche Rückschritt war enorm. Die erste Welle der Emanzipation (Weimarer Republik) war durch NS-Zeit und den Krieg ausgelöscht.
- Die Wirtschaftswunderjahre waren geprägt durch ein "Zurück zur Normalität“ → es gab ein konservatives Familienbild, klar getrennte Rollen: Mann = Ernährer, Frau = Hausfrau und Mutter.
- Rückbildung und Wochenbett verschwanden weitgehend aus dem öffentlichen Gesundheitsdiskurs – Fokus lag auf "schnell wieder funktionieren“ im Haushalt und das Land wieder aufbauen (auch nicht so viel anders als heute. Zack zack, wer hat schon den "Luxus" im Bett zu liegen und sich zu erholen?).
- Die "Fürsorge“ aus der NS-Zeit wurde nicht als staatliche Aufgabe fortgeführt – außer in Form traditioneller Familienideale.
- Medizinische Versorgung: Krankenhausgeburten wurden ab den 50ern zur Norm - nicht aus Überzeugung, sondern aus dem wachsenden Einfluss der Medizin.
- Hausgeburten gingen zurück. Das war oft (und ist auch oft noch so) mit Entmachtung der Hebammen und Verlagerung von Kontrolle ins ärztliche System verbunden.
- Care-Arbeit nach der Geburt blieb Privatsache, und wer keine familiäre Hilfe hatte, stand oft allein da.
In Ostdeutschland:
Schlug der Staat einen anderen Weg ein:
- Mutterschaft wurde stark staatlich eingebettet, Frauen wurden in den Arbeitsmarkt integriert.
- Wochenbett- und Müttererholungsheime gab es tatsächlich (z. B. für 2–3 Wochen nach der Geburt) – aber auch hier als Teil einer staatlichen Strategie, produktive Arbeitskräfte zu sichern, nicht primär als Fürsorge oder Selbstfürsorge Förderung. Mütter sollten so früh wie möglich wieder arbeiten gehen, unterstützt durch Mutterschutz, Kitas und sogar eben Erholungsheime für Wöchnerinnen. Doch auch hier ging es weniger um individuelle Wahlfreiheit als um die Sicherung der Arbeitskraft.
Zwei Systeme, zwei Ideologien – und doch dieselbe Lücke: Echte Selbstbestimmung der Frauen blieb auch nach 1945 die Ausnahme.
Zwei Modelle, zwei Systeme – und doch dieselbe Grundbotschaft: Eine "gute“ Mutter ist die, die alles schafft, ohne zu klagen.
Das Ideal, dass Mütter "das schaffen“ – ob im Heimchen-am-Herd-Modell oder in der "Supermom“-Variante – hat ganz deutliche historische Wurzeln.
Postnatale Fürsorge und Pflege ist in Deutschland bis heute nicht systematisch verankert.
Sie ist entweder privates Glück, je nach Umfeld und Geld, oder eben medizinisch auf "Fehler suchen“ ausgelegt statt auf ganzheitliches Begleiten.
(Dazu gleich mehr).
Die Nationalsozialisten regierten offiziell zwar nur zwölf Jahre – von 1933 bis 1945.
Aber der kulturelle und ideologische Einfluss ging locker über 30–40 Jahre hinaus.
Das Frauenbild und das ideologische Gedankengut konnten sie erstens schon vor 1933 vorbereiten und nach 1945 wirkte es in Teilen weiter:
Schon in den späten 1920ern gab es in konservativen und völkischen Kreisen (das waren Gruppen und Bewegungen, die schon vor der NS-Zeit eine radikal nationalistische, rassistische und antisemitische Ideologie vertraten) eine Gegenbewegung gegen die "Neue Frau“ der Weimarer Republik.
Die NS-Propaganda griff diese Strömungen auf und hat sie verstärkte.
Viele Strukturen, Personen und Denkweisen haben nach 1945 einfach weiter existiert.
Nach dem Krieg verschwanden diese Denkmuster nicht einfach:
Viele Ämter, Schulen und Behörden waren weiterhin mit denselben Personen besetzt, die diese Ideale verinnerlicht hatten.
So lebten die alten Rollenvorstellungen in der Nachkriegszeit fort – oft unter neuem, bürgerlich-konservativem Deckmantel – und prägten ganze Generationen.
Die konservative Nachkriegspolitik in Westdeutschland hat am Ende ähnliche Rollenbilder vertreten (wenn auch ohne NS-Ideologie), und gesellschaftliche Bilder von "Frauen- und der Mütterrolle“ verändern sich einfach oft sehr viel langsamer als Gesetze.
Faktisch wurde das Frauenbild aus der NS-Zeit also im Prinzip erst in den 1970ern mit der zweiten Frauenbewegung spürbar in Frage gestellt.
Bis dahin war "Hausfrau und Mutter“ für viele noch der unangefochtene Standard.
Die zweite Welle des Feminismus in den 70ern
Vor allem jungen Frauen der Nachkriegsgeneration, die in den 50ern und frühen 60ern aufgewachsen waren, wurde das irgendwann zu dumm.
Sie waren besser gebildet als ihre Mütter, viele hatten Abitur, manche studierten – aber sobald sie heirateten, wurden sie gesellschaftlich (und oft auch rechtlich) wieder auf Hausfrau reduziert.
Auch Frauen, die im Krieg gearbeitet hatten, waren nach 1945 in alte Rollen gedrängt worden.
In den 60ern merkten viele junge Frauen, dass sie trotz Bildung und neuer Freiheiten immer noch im alten Korsett steckten:
Ehe bedeutete Abhängigkeit, Berufstätigkeit war oft verboten oder gesellschaftlich geächtet.
Sie lasen, diskutierten, gründeten Gruppen – und entdeckten, dass ihr "persönliches Problem“ ein strukturelles war (auch nicht anders als heute).
Der Frust wuchs so lange, bis daraus die zweite Welle der Frauenbewegung wurde.
Warum kam es zu einer Bewegung?
- Es gab einfach einen großen Widerspruch zwischen Anspruch & Realität: Bildung war möglich, Selbstverwirklichung aber kaum – Heirat bedeutete oft Berufsverbot.
- Frust über rechtliche Abhängigkeit: Bis 1977 (!) brauchten verheiratete Frauen in der BRD die Zustimmung ihres Mannes, um arbeiten zu dürfen
- Viele Frauen waren Teil der 68er-Bewegung, merkten aber, dass auch dort Männer dominierten – also gründeten sie eigene Frauengruppen.
- Frauen, die "mehr“ wollten als Familie, galten als egoistisch oder "Rabenmütter“. (Auch oft ähnlich wie heute. Zumindest das Gefühl egoistisch zu sein, ist ganz stark vertreten). Es gab sehr viel gesellschaftlichen Druck auf Frauen, sich der "Norm" anzupassen.
- Es gab Abwertung: Feministinnen, oder einfach Frauen, die mehr Rechte und mehr Gleichberechtigung haben wollten, wurden als hysterisch, hässlich, männerfeindlich karikiert, lächerlich gemacht.
- Selbst offensichtliche Benachteiligungen wie das Ehegattenarbeitsverbot oder das gesetzliche Recht des Mannes, den Wohnort zu bestimmen, fielen erst sehr spät. Gesetze ändern sich nur langsam. Denn dazu müssen ja die Männer die Gesetze neu machen.
Die zweite Welle in den 60ern bis 80ern ging noch tiefer als die erste.
Es ging um:
🌿 Die Aufhebung der traditionellen Rollenverteilung (Hausfrau vs. Ernährer). Sie stellte die Rollenbilder infrage. Sie wollte die Abschaffung des "Leitbilds Hausfrau“.
🌿 Sexuelle Selbstbestimmung. Zugang zu Verhütungsmitteln und sicheren Schwangerschaftsabbrüchen.
🌿 Sie kämpfte für die Sichtbarmachung von unbezahlter Care-Arbeit und den Ausbau von Kinderbetreuung.
🌿 Gleichberechtigung in Bildung und Beruf. Recht auf Erwerbstätigkeit ohne Zustimmung des Mannes (in der BRD erst 1977 erreicht). Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Bildung für Mädchen.
🌿 Und es ging um eine kritische Auseinandersetzung mit Mutterschaft und Ehe.
In Frage gestellt wurde:
– Warum ist Hausarbeit keine "richtige" Arbeit?
– Warum ist Mutterschaft heilig, aber unsichtbar?
– Warum wird weibliche Wut pathologisiert – und männliche gefeiert?
– Warum dürfen/sollen Frauen arbeiten – aber sollen trotzdem ALLES andere "nebenbei" managen?
Trotz Fortschritten blieben viele alten Erwartungen bestehen.
Es entstand also ein doppeltes Idealbild:
Die Frauen sollten arbeiten und auch noch den Haushalt managen.
"Du darfst alles – aber du musst auch alles (zusätzlich und noch viel mehr).“
Dass wir erst 1977 in Deutschland das Gesetz geändert haben, damit Ehefrauen ohne Erlaubnis des Mannes arbeiten dürfen – das ist keine 50 Jahre her.
Ein paar historische Fakten, die verdeutlichen, wie jung manche Rechte sind:
Erst 1958 durften verheiratete Frauen ihr eigenes Bankkonto und ihr eigenes Vermögen haben.
Erst 1977 durften Ehefrauen selbst einen Arbeitsvertrag unterschreiben, ohne ihren Ehemann zu fragen.
Erst 1997 wurde Vergewaltigung in der Ehe gesetzlich verboten.
Das ist unsere jüngste Vergangenheit.
Die 70er waren eine Zeit der Aufbrüche, aber auch der heftigen Gegenwehr – von der Politik, von konservativen Kräften und durch hartnäckige gesellschaftliche Erwartungen.
Die Supermom heute
Heute ist die Supermom nicht verschwunden – sie hat nur ihr Outfit gewechselt.
Sie heißt jetzt nur nicht mehr "Hausfrau", sondern
- Care-Arbeit leistende Person
- Vollzeit-erziehende Bezugsperson
- Haushalts- und Familienmanager*in
- Primary Caregiver
- Zuhause tätige Ressourcendisponent*in
Frisch aus dem "Gender Seminar", weichgespült und "modern" bei genau gleicher Arbeit und gleichen Erwartungen – nur das Etikett ist anders. .
Und trotzdem immer noch nicht wertgeschätzt, immer noch überlastet und unbezahlt. Immer noch das selbe Rollenbild in Tarnfarbe.
Und ich meine das nicht Gender-abwertend, aber das hat eine ausgesprochene Doppelmoral und nicht besonders viel "Inklusives" für Mütter
Was auf den ersten Blick "neutral" oder inklusiv klingt, lenkt im Prinzip aber, wenn man es genau nimmt, nur vom eigentlichen Problem ab und verdeckt das, was wirklich dahinter steckt – die selbe unfaire Arbeitsteilung und Unterstützung wie vor 50 und vor 100 Jahren.
Und während wir uns über neue Etiketten beugen, fehlt vielerorts immer noch das, was Mütter nach der Geburt wirklich bräuchten:
Verlässliche, systematische Pflege, Unterstützung und ausreichende Regeneration – ohne dass sie darum kämpfen müssen.
Aus der makellosen Hausfrau von damals, im Kleid mit gebügeltem Hemd in der Hand, wurde die durchtrainierte, erfolgreiche Social-Media-Mutter, die ihr Leben präsentiert.
Heute ist es die Marathon laufende, selbstständige, Insta Mutter, die "nebenbei“ ein perfekt dekoriertes Zuhause hat, die auf Bio-Essen achtet, die Yoga macht, ihre Haut straff hält und ihre mentale Stärke mit Meditation pflegt. Und die natürlich auch noch Zeit für Paarabende, Weiterbildung und Selbstoptimierung hat, während sie den Haushalt schmeisst, einkaufen geht, kocht, staubsaugt, die Blumen gießt, Wäsche zusammenlegt, die Schwiegereltern mit Kuchen überrascht und den Hund Gassi führt. (Und es ist trotzdem nie genug und nie gut genug, wohlgemerkt).
Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wie viele der Mütter-Influencerinnen plötzlich weinend in einem Video posten, dass sie nicht mehr können und dass "von heute auf morgen" ihr Leben so schrecklich ist?
Oder da folgt man jemandem wegen der Dekos, den Rezepten, den Mama Tipps.... und dann hörst du monatelang nichts mehr. Bis irgendwann mal wieder ein kleiner Post kommt, dass sie jetzt weniger bei Insta machen wollen, weil Burnout.
Wir wissen alle, dass diese Insta-Leben nicht normal sind und dass man das nicht lange aufrecht erhalten kann. Und trotzdem beeinflusst uns das!
Die meisten Frauen, die ich kenne, hamstern oft ziemlich alleine vor sich hin in ihrem Rad.
Leistung ist zur Norm geworden.
Erschöpfung oft hat sich zur Schuldfrage entwickelt.
Du bist müde? Dann bist du wohl schlecht organisiert. Oder hast zu wenig meditiert und dein Mindset verändert.
Die Supermom lebt heute mehr denn je.
Das erlebe ich in meiner Arbeit mit unzähligen Frauen fast täglich und das seit Jahren, seit ich arbeite.
Und eben, eigentlich egal, ob Mom oder nicht.
Die Vorstellung bzw. die Fantasie der Superwoman oder Wonderwoman ist total real!
(Und nicht nur in den Frauen selber. Auch in den Männern. Viele erwarten das genau so und sich total überrascht, wenn das überhaupt nicht leistbar ist).
Ganz viele Frauen sind in diesem Gedanken- und Hamsterrad gefangen und auch in gesellschaftlichen Zwängen.
"Aber ich muss doch, aber ich kann doch nicht."
Und sie fühlen sich als Versager, wenn sie diese überzogenen Anforderungen nicht oder nicht lange halten können.
Strukturelle Ursachen: Care-Arbeit bleibt unsichtbar
Das Ganze ist leider immer noch ein System Problem.
Das Supermom - Syndrom ist kein individuelles Problem – es ist das Produkt eines Systems, das Fürsorgearbeit auslagert und abwertet. Dem Frauen im Allgemeinen und im Speziellen nach der Geburt einfach nicht wichtig genug sind.
Es ist staatlich nie genug Geld da offiziell.
Die Prioritäten liegen ganz eindeutig auf anderen Dingen, in die "Notfall-mäßig" investiert werden muss.
Es wird immer einen Notfall geben.
Kriege, Aufrüstung, Pandemien, dubiose Maskenkäufe, wo Milliarden in private Hände fließen und Kliniken nichts davon gesehen haben, Klima, die Energiekrise (oder auch nicht. Das fällt ja dann auch hinten runter, wenn Kriege und Migranten im Vordergrund stehen).
Es ist längst keine Verschwörungstheorie mehr, dass Krieg als Businessmodell funktioniert.
Das ist ein gut dokumentierter und leider historisch wie aktuell relevanter Fakt. Da gibt es sehr seriöse und gut recherchierte Bücher drüber. Nicht immer ist es das Ziel einen Krieg zu beenden, wenn er viel Geld einbringt. Rüstung ist ein Geschäft. Und es ist ein Männer-Geschäft.
Oder wenn lieber Milliarden in die Entwicklung von KI investiert werden, als in die Versorgung in Krankenhäusern.
Es ist längst keine Verschwörungstheorie mehr, dass Krieg als Businessmodell funktioniert. Das ist ein gut dokumentierter und leider historisch wie aktuell relevanter Fakt. Da gibt es sehr seriöse und gut recherchierte Bücher drüber
Wir alle kennen das Problem. Ich sag's aber gerne noch mal.
Pflegekräftemangel, Unterbezahlung selbiger, Geburtshäuser sind ein Auslaufmodell, Frauenkliniken müssen sich wirtschaftlich lohnen, Hebammen werden eingespart.
Gelder werden ganz schnell locker gemacht, wenn es um einen angeblichen "Notfall" geht.
Aber für Mütter... da heißt es: Sorry, aber die Kassen sind leer.
Wenn es um Mütter und Familien geht, müssen selbst kleine Beträge immer wieder neu gerechtfertigt werden, 100 Anträge gestellt werden, die dann nach 5 Jahren abgelehnt werden.
Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema.
Viele der unterschwelligen Erwartungen an Mütter und Frauen kommen aus genau diesen Strukturen, die die zweite Welle in den 70ern angekratzt hat– aber nicht beseitigt hat:
Warum müssen wir immer noch um Abtreibungsrecht und Gleichbezahlung kämpfen?
Wir leben in einer patriarchalen Welt und in einer patriarchalen Medizin, wo Medikamente fast nur an Männern getestet werden und Frauen oft die Dosis gar nicht vertragen und dann mit "kann doch gar nicht sein" abgefertigt werden (und der ganze andere Rest, der nicht zu Frauenkörpern passt).
Viele, viele Frauen fragen sich ständig, warum sie so falsch sind. Warum sie nicht mehr können und warum sie so "schwach" sind.
Diese "Imprints", diese Prägungen, sind immer unterschwellig da.
Wir treffen sie überall!
Und da die Wichtigkeit des Themas so unwichtig ist für unser ganzes System, kommen Frauen sehr schnell in die Gedankenschleife, dass sie "es" nicht verdient haben, dass sie "es" nicht wert sind und, dass sie unwichtig sind.
Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen.
Und ich bin mir fast sicher, dass alles, was aufklärt und nicht patriarchalisch konservativ ist, ganz schnell als links-radikal gilt 😂🤪 aber das ist mir jetzt völlig egal. Das hat nichts mit einer politischen Strömung zu tun. Das ist mir so schnuppe.
Mir geht's nur darum aufzuklären, warum sich Frauen immer so falsch fühlen und warum sich immer noch nicht richtig und wertschätzend gekümmert wird.
Und ich komme auch gleich dazu, warum das für so viele Frauen ernsthaft gesundheitlich schädlich ist.
Heute wird von Frauen erwartet, dass sie alles stemmen können (alleine am besten) ohne sich zu beklagen.
Oma und Uroma haben sich auch nicht beklagt. Und oh man, was die arbeiten konnten mit 7 Kindern auf dem Feld. Und das ohne Essen im oder nach dem Krieg. Die haben Deutschland wieder aufgebaut.
Ohne Pause. Ohne Netz. Ohne Anerkennungssystem. (Mit Blasensenkung und Inkontinenz... nie beschwert).
Heute sehen wir die Frauen vielleicht nicht mehr auf dem Feld, wir sehen sie eben sehr oft bei Instagram oder aus diversen Motivationen heraus 4 Monate nach der Geburt im Fitness Studio.
Die SUPERMOM ist das Produkt eines Systems, das sich im Prinzip nicht wirklich verändert hat.
Und das Fürsorgearbeit auslagert, abwertet und unsichtbar macht.
Was macht das System heute (Wirtschaft, Politik, Gesellschaft)?
Es sagt sinngemäß:
"Klar, Fürsorge ist wichtig. Aber nicht wirklich unser Problem.“ (Zumindest nicht wichtig genug, um etwas zu ändern).
Und dann wird die Arbeit "ausgelagert“, z. B.:
🤍 In die Familie – meist zur Frau.
"Das macht die Mutter schon.“
"Die Tochter pflegt die Eltern.“
"Sie arbeitet ja nur halbtags, das geht doch.“
🤍 In schlecht bezahlte Jobs – oft von anderen Frauen.
– Kita-Erzieherinnen
– Pflegekräfte
– Haushaltshilfen
– Frauen, die fern ihrer eigenen Familien Care-Arbeit leisten, oft mit Migrationshintergrund, unterbezahlt und auch unsichtbar (und es ist ja so viel wichtiger auf dem Migrationshintergrund rumzudreschen, als anzuerkennen, wie viel Arbeit viele leisten und die Menschlichkeit zu sehen).
🤍 In unsichtbare Zuständigkeiten
– Mental Load: Wer denkt an den Elternabend?
– Emotionale Arbeit in Beziehungen: Wer reguliert, vermittelt, hört zu, tröstet weinende Kinder, bleibt zu Hause, wenn das Kind krank ist?
Warum das problematisch ist:
Weil Fürsorgearbeit lebenswichtig ist – aber nicht als solche anerkannt wird.
Sie ist Grundlage für unser aller Leben. Ohne Mütter keine Kinder, keine Gesellschaft.
Sie wird aber:
– nicht bezahlt (oder schlecht)
– nicht gesehen
– nicht strukturell unterstützt (z. B. durch Zeit, Räume, Systeme)
Ja klar, es gibt heute politische Unterstützung für Familien – zumindest auf dem Papier.
Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld, Kita-Ausbau, Mutterschutz, steuerliche Vergünstigungen.
Klingt gut, oder?
In der Praxis sieht es so aus:
- Elternzeit: Frauen nehmen im Schnitt 10 Monate, Männer meist nur den "Pflichtanteil“ – und schwupps, sind wir wieder im alten Rollenmodell. Gehen die Frauen nach einem Jahr Elternzeit wieder arbeiten und der Mann bleibt zuhause, sind die Frauen oft so ausgelaugt und müde, dass das Burnout nicht mehr weit ist.
- Kita-Plätze: Theoretisch vorhanden, praktisch mit Warteliste, Schließzeiten und Öffnungszeiten, die nicht zu einem 8-Stunden-Tag passen.
- Mutterschutz: Endet 8 Wochen nach der Geburt – danach ist "wieder fit werden“, "wieder gesund werden" Privatsache
- Ehegattensplitting: Belohnt das Modell "ein Vollverdiener, ein Zuverdiener“ – rate mal, wer meistens der Zuverdiener ist. Und die Männer verdienen in der Regel eh mehr als die Frauen
- Pflegegeld & Familienpflegezeit: Auch hier springen überwiegend Frauen ein – unbezahlt oder für ein Taschengeld.
- Kurz gesagt: Die Überschriften klingen nach Fortschritt, die Umsetzung hält Supermom weiter auf Trab.
Unser politisches Klima heute:
1. Fehlende echte Wahlfreiheit:
Politische Programme fördern meist entweder Vollzeiterwerbstätigkeit oder lange häusliche Betreuung – aber kaum flexible Modelle, die beides in verschiedenen Lebensphasen ermöglichen.
Frauen passen sich daher oft den Strukturen an, statt umgekehrt.
2. Betreuungsinfrastruktur mit Lücken:
Zu wenig Kitaplätze, unpassende Öffnungszeiten, lange Wartelisten.
Ganztagsangebote in Schulen sind oft noch Flickwerk.
Folge: Viele Mütter reduzieren ihre Arbeitszeit oder geben den Beruf ganz auf. Viele Mütter haben viele Fehlzeiten im Job, wenn das Kind krank ist und sie zuhause bleiben müssen. Fehlende Mitarbeiter gefallen keinem Arbeitgeber.
3. Ungleiches Elterngeld- und Elternzeitmodell:
In der Praxis nehmen Frauen den Großteil der Elternzeit, Männer oft nur den "Pflichtmonat“ – verstärkt das Rollenbild.
Fehlanreize: Wer länger aussteigt, verliert beruflich an Anschluss und Gehalt.
4. Teilzeitfalle & Gender Pay Gap:
Teilzeit wird fast automatisch zur "Mütterfalle“ – geringere Aufstiegschancen, Altersarmut, weniger Rentenansprüche.
Lohnlücke bleibt bestehen, weil Care-Arbeit weiterhin unbezahlt oder schlecht bezahlt ist.
5. Fehlende Anerkennung unbezahlter Care-Arbeit
Gesellschaft und Politik messen "Wert“ oft nur in Erwerbsarbeit, nicht in Fürsorgeleistung.
Wer zu Hause bleibt, gilt schnell als "nicht berufstätig“, obwohl Care-Arbeit harte Arbeit ist.
6. Mangelnde postpartale Versorgung:
Kein flächendeckendes Konzept für Rückbildung, Regeneration auf lange Sicht, psychische Gesundheit nach der Geburt.
Hebammenmangel, Pflegekräftemangel, Unterbezahlung in sämtlichen sozialen Jobs, verschärft die Lücken.
7. Politische Debatte ohne Tiefgang:
Familienpolitik wird oft auf Wirtschaftsförderung oder Geburtenrate reduziert, statt auf individuelle Lebensqualität und echte Gleichstellung zu setzen.
Die Gefahren des Supermom - Syndroms
😔 Warum das auch für den Körper gefährlich werden kann:
Das Supermom-Syndrom ist nicht nur ein mentales Thema – es hat körperliche, emotionale und soziale Folgen:
- Chronische Erschöpfung, Schlafstörungen, hormonelle Dysbalancen, Migräne
- Schuldgefühle, Angst, depressive Verstimmungen
- Rückzug aus Beziehungen, soziale Isolation
- Schwierigkeiten beim Bonding oder beim Einlassen auf Begleitung
- Körperlich: Schmerzen, Müdigkeit, Stress Symptome, verlangsamte Rückbildung, Beckenbodenprobleme, Verspannungen, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme und und und...
👉 Und oft: Verspätete oder gar keine fachliche Unterstützung.
Die Mentale Selbstoptimierung:
Dieses "Ich muss nur mein Mindset ändern“ und auch "Wir arbeiten an den Glaubenssätzen" und die "Ich kann das und schaff das" Mantras klingen zuerst harmlos, sind aber oft echte Fallstricke.
Manchmal sogar pures Gaslighting:
- Meditier doch.... damit du noch mehr leisten kannst.
- Du bist nicht erschöpft.... du musst nur lernen, besser mit deiner Erschöpfung umzugehen.
- Du musst nur an dich glauben, dann kannst du das auch. "Und weiter geht's".
Das Problem:
In manchen Therapie- oder Coaching-Kontexten, liegt der Fokus so stark auf Anpassung an belastende Umstände und Coping Mechanims (also, wie man mit dem Stress umgeht), dass die Ursachen völlig aus dem Blick geraten oder sogar ohne das Umfeld oder die strukturellen Ursachen überhaupt zu hinterfragen. Dann wird aus "Ich stärke deine Ressourcen“ schnell "Ich trainiere dich, deine Überlastung besser zu ertragen."
Dann geht es nicht mehr um Entlastung, sondern darum, dich so fit zu machen, dass du weiter im gleichen ungesunden System funktionierst.
Das ist, als würde man einem Marathonläufer mit gebrochenem Fuß beibringen, mental über den Schmerz hinwegzusehen – statt ihm Krücken zu geben und das Rennen zu stoppen.
Und genau das passiert vielen Müttern: Statt dass wir das Umfeld ändern, trainieren wir sie, länger in einem Umfeld zu bleiben, das sie krank macht.
Wenn ich das System anschaue, in dem Mütter heute leben, dann erkenne ich darin schon so etwas wie Narzisstische Dynamiken.
Das System lebt davon, dass du gibst – Zeit, Energie, Fürsorge, Aufmerksamkeit.
Es saugt deine Ressourcen auf, als wären sie selbstverständlich, und es applaudiert dir vielleicht sogar kurz dafür – solange du lieferst.
Doch wenn du an deine Grenzen kommst, wenn du nicht mehr funktionierst, dann gibt es keine echte Unterstützung.
Stattdessen kommt die Schuldumkehr:
"Du bist zu empfindlich. Du musst dich besser organisieren. Du musst dein Mindset ändern. Du musst resilienter werden.“
In einer gesunden Beziehung würde jemand sagen:
"Ich sehe, da sind deine Grenzen und ich wertschätze sie. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen. Das ist zu viel für dich. Wir müssen etwas ändern. Ich trage das mit.“
Ein narzisstisches System sagt:
"Du musst lernen, besser mit dem, was ich dir zumute, klarzukommen.“
Das ist nicht nur fehlende Fürsorge – das ist emotionale Manipulation auf Systemebene.
Es verschiebt die Verantwortung für Überlastung dorthin, wo sie nicht hingehört: Auf die, die eh schon alles tragen.
Und das gilt nicht nur für Mütter im individuellen Alltag – es gilt auch oft für das, was wir als "Familie“ definieren.
Unser dominantes Familienideal hat ebenfalls narzisstische Züge:
Es präsentiert sich nach außen als liebevoll, fürsorglich und stabil – aber es basiert oft darauf, dass eine Person (historisch: Die Frau, die Mutter) einen unverhältnismäßig großen Teil der Fürsorge, Organisation und emotionalen Arbeit übernimmt.
Wenn du als Mutter sagst: "Ich kann und will nicht alles allein tragen“, dann kann das wie ein kleiner Erdbebenstoß wirken. Das muss auch nicht zwingend ein Problem mit dem Partner sein. Aber die Strukturen sind ja in einer Familie noch viel weiter gestrickt.
Plötzlich entstehen Spannungen – vielleicht in der Partnerschaft, mit den eigenen Eltern oder Schwiegereltern.
Manchmal auch mit Freundinnen, die in einer ähnlichen Rollenverteilung leben.
Das hat oft nichts mit böser Absicht zu tun.
Viele Menschen – auch Partner – haben diese Strukturen selbst von klein auf gelernt und empfinden sie als selbstverständlich.
Wenn du sie infrage stellst, fühlt sich das für manche an wie ein Angriff auf ihre eigene Lebensweise
oder sogar auf ihre Identität als "gute Mutter“, "guter Vater“ oder "intakte Familie“.
Aber genau deshalb ist es so schwierig:
Wer den Finger auf die Lastenverteilung legt, wird oft zum Auslöser für Diskussionen und emotionale Abwehr – obwohl es eigentlich um Gerechtigkeit und gegenseitige Unterstützung geht.
Und es geht ja nicht nur um die Lastenverteilung. Es geht auch darum, was, wenn einer ausfällt. Vor allem, was, wenn die Mutter ausfällt? Was, wenn sie so starke Geburtsfolgen hat, dass es ihr schlecht geht? Was, wenn sie den erwarteten Alltag nicht schafft? Was, wenn sie eine postpartale Depression hat (die im übrigen nicht so rucki zucki immer erkannt werden. Eine "Anpassungsstörung" wird ja schnell mal diagnostiziert, heißt, sie muss halt lernen, sich anzupassen, das geht schon wieder vorbei).
Und nicht selten folgt dann wieder die Schuldumkehr.
Statt gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wird der Fokus plötzlich auf dich gelenkt:
"Du bist zu empfindlich.“
"Du interpretierst da zu viel hinein.“
"Du machst Probleme, wo keine sind.“
Das ist besonders bitter, weil viele Frauen in solchen Momenten ohnehin schon an ihrer Belastungsgrenze sind.
Und hinzu kommt IMMER, der Körper, der sich durch Schwangerschaft und Geburt extrem verändert hat und der in diesem Zustand einfach Ruhe und Erholung braucht.
Die Kritik an der Lastenverteilung wird so verdreht, dass sie sich am Ende noch schlechter fühlen –
schuldig, undankbar, als würden sie die Harmonie zerstören und zu viel wollen.
Natürlich gilt das nicht für alle Partnerschaften oder Familien.
Es gibt Partner, die wirklich hinhören, mittragen und neue Wege gehen wollen.
Aber das entbindet uns nicht davon, das Muster zu benennen, das es definitiv gibt und das so viele Frauen in die Falle von Selbstzweifel und Selbstvorwürfen treibt.
Männer haben sehr viel mehr Freiheiten und nehmen sie sich auch.
Wie Sabine Friese-Berg so schön sagt: Dann gehste halt mal 2 Jahre nicht Fußball spielen. Ja und?
Und sie sagt: Möbelhaus kannste später immer noch. Sprich: Sauber geleckt und ultra aufgeräumt.
Die meisten Menschen sehen leider nur ihre eigene Erwartungserfüllung.
Sie akzeptieren nicht, dass du gerade etwas anderes brauchst. Dass du gerade etwas brauchst! Und nicht so viel "geben" kannst vielleicht.
Wir leben ja in einer Welt von "Nehmern". Und wenn die nicht bekommen, was sie brauchen, dann kann das manchmal echt schwierig werden.
Sie hören nicht zu und können nicht von "Ich will aber" umstellen auf "Ich sehe dich".
Sie sehen nur ihre eigenen Vorstellungen von dir oder ein Ideal, das du erfüllen musst.
Und, wenn du das nicht tust, bist du fehlerhaft.
Diese Muster hören nicht an der Haustür auf.
Das, was wir in Familien und Partnerschaften sehen – die unausgesprochenen Erwartungen, die Schuldumkehr, die stille Forderung, "einfach besser klarzukommen“ – das begegnet uns auch als Fachfrauen in der Arbeit mit Müttern.
Auch in uns selber zum einen. Die Erwartungen, die wir uns selber aufbürden und die brutale Selbstverurteilung, wenn wir "zu schwach" sind.
Aber auch im Umgang mit den Frauen.
Auch wir als Therapeutinnen, Hebammen oder Trainerinnen sind halt oft auch nicht frei von diesen Bildern.
Manchmal bestärken wir das Supermom-Syndrom ungewollt – z. B. wenn wir:
- … "Heldinnen" feiern, statt echtes Bedürfnis zu sehen (wie diese eine frische Mutter bei Insta, die nach 6 Monaten Marathon gelaufen ist und dabei noch ihr Baby gestillt hat.... alle feiern und bejubeln sie. Ich hab gedacht ich müsste tot umfallen. HALLO????? Völlig verzerrte Welt. Die Überschrift war ungefähr so: Deshalb hat das Patriarchat Angst vor Frauen. Ich würde dagegen halten: Das Patriarchat lacht sich eins ins Fäustchen, weil wieder eine Mutter mehr auf den Erfolgszwang, den Höchstleistungsdruck, die Selbstoptimierung und auf "ich kann das und schaff das alles ultra mega selber und alleine" reingefallen ist. Und das hat nicht mit einer konservativen Haltung zu tun, dass man keinen Sport machen soll oder darf nach der Geburt. Es geht darum dieses völlig Übertriebene nicht auch noch anzufeuern, so dass die "Normalfrau" denkt, sie müsste und sollte das auch können).
- … mit "Du schaffst das!“ motivieren, obwohl eigentlich Pause nötig wäre.
- … viel mehr an Übungen und "fit werden" denken als an Nervensystem-Regulation und Regeneration.
- … Checklisten abarbeiten, statt Raum für echte Begleitung zu geben.
💥 Wenn wir das Supermom-Syndrom nicht hinterfragen, normalisieren wir ein ungesundes Muster.
➡️ Wir reden hier nicht nur über individuelles Verhalten, sondern über gesellschaftliche Muster, die durch Wiederholung zur "Norm“ werden – und genau das wollen wir aufbrechen.
Das ist meine Arbeit mit allem, was ich tue.
Das ist der Kern meiner Arbeit mit Frauen nach der Geburt.
Mit all den Behandlungen und der Pflege, die ich am liebsten allen Müttern zukommen lassen möchte.
Meine Arbeit ist mein Beitrag, das System zu verändern: Frauen nach der Geburt sollen nicht allein vor sich hin kämpfen oder vielleicht sogar leiden, sondern die Fürsorge und Behandlung erhalten, die ihnen zusteht.
Das ist mir wirklich sehr sehr wichtig.
Und mir liegt sehr am Herzen, dass die Frauen sich nicht mit wirklich ungesunden Methoden komplett auspowern bis sie krank werden.
Ich will ausbalancieren. Das Nervensystem und der ganze Körper brauchen das nach der Geburt.
Ich meine, willst du ein Baby sein, dass während eines Marathons mal eben gestillt wird?
Meinst du nicht das fördert Verdauungsprobleme für das Kind?
Klar, sie rennt ja nicht jeden Tag den Marathon. Aber mit Sicherheit trainiert sie jeden Tag. Und das höchstwahrscheinlich recht exzessiv.
Und natürlich sind ja nicht alle Frauen so, aber man sieht das und ich bin mir sicher, dass oft unbewusst so generelle Selbstzweifel anfangen. ich müsste mehr Sport machen. Ich muss mich nur überwinden. Ich muss den Arsch hoch kriegen. Der Bauch muss weg. Oh Mist, ich wiege immer noch 5 (oder auch 20) Kilo zu viel und und und.
Unsere Fortbildung "Postpartum Pro" öffnet übrigens im Oktober wieder.
Wenn du auch so arbeiten möchtest.
Ganzheitlich mit der gesamten Frau im Blick, dann kannst du dich gerne in die Warteliste eintragen. Wir haben auch eine kleine Überraschung für dich.
Wir müssen diese Muster aufbrechen und sie sehen.
Wir müssen uns bewusst machen, was tatsächlich los ist.
Wenn Leistung zur Norm wird, wird Erschöpfung zur Schuldfrage.
Dann glauben Frauen, sie müssten nur "besser organisiert" sein, "achtsamer", "positiver", "dankbarer".
Und wenn sie das nicht sind?
Dann fühlen sie sich falsch und/oder werden tatsächlich schräg angeschaut von der Gesellschaft und sogar der eigenen Familie.
Ich sehe das ganz besonders auffällig, wenn die Frauen nach der Geburt eben nicht "funktionsfähig" sind, weil sie Verletzungen haben, die sie einschränken körperlich und/oder seelisch.
Das ist soziales und politisches Brachland. Wüste Gobi.
Wir leben in einer Welt, die Fürsorge erwartet – aber nicht trägt.
Eine Welt, die Mütter in Verantwortung schiebt – aber nicht in Sichtbarkeit (und auch nicht in Sicherheit, Stichwort Rentenverarmung bzw. Altersarmut von Frauen).
Das macht müde.
Frauen sind müde – und glauben, sie sind selbst schuld.
Männer sind auch müde, aber anders.
ABER:
Du bist nicht falsch.
Das System ist es.
Ein Nervensystem, das permanent auf Hochtouren arbeitet, für alles verantwortlich ist, organisiert, reguliert und sich selbst dabei vergisst, wird irgendwann laut.
Mit Schlafproblemen, Schmerzen, Krankheiten, Reizbarkeit oder dem Gefühl: Ich kann nicht mehr. Ich schaff das nicht.
Das ist kein Fehler in DEINEM System
Du bist auch nicht zu schwach oder zu sensibel.
Du reagierst gesund auf ein ungesundes Ideal.
Das ist super wichtig!
Du reagierst gesund!
Auf ein System, das ungesund ist!
Auf ein System, das dich nicht trägt!
(Krass aber so ist es)
Die zweite Frauenbewegung hat wichtige Türen aufgestoßen.
Und es ist einfach unverständlich, warum das alles immer so mühsam ist.
Aber:
Das System dahinter – kapitalistisch, männlich geprägt, leistungsorientiert – wurde nicht verändert und hat die neuen Rechte einfach in seine alte Logik eingepasst.
"Du darfst jetzt alles.“
Aber du musst es auch.
Und wehe, du versagst dabei.
Das ist ein bißchen wie die späte Bestrafung.
Ergebnis:
Wir haben heute…
– Wahlfreiheit – aber keine strukturelle Unterstützung.
– Selbstbestimmung – aber kaum Raum zur Regeneration.
– Berufstätigkeit – aber damit oft Überbelastung und keine echte Neubewertung von Care-Arbeit.
– Empowerment-Rhetorik – aber kaum echte Veränderung von Machtverhältnissen.
– Eine Welt mit bezahltem Mutterschafts-"Urlaub" , in der das Wochenbett und Erholung aber trotzdem Luxus sind und meistens gar nicht eingehalten wird.
Und wehe du brauchst zu lange, um dich zu erholen!
– "Kurse für Mütter", aber keine wirkliche Heilung.
Die Postpartum Welt läuft im Prinzip genau wie der Rest der Welt:
Sehr oft leistungsorientiert, die weibliche Biologie und Physiologie wird ignoriert, Schwachstellen und Verletzungen werden ignoriert, es gibt genaue Vorstellungen, wann was wieder zu funktionieren hat, egal, wie die tatsächliche Situation eigentlich ist.
Es wird gepuscht und gepuscht und gepuscht.
Alles, was nicht "der Norm" (die es gar nicht gibt) entspricht, ist "falsch" und eben "nicht normal."
"Zurück zum alten Ich." Eine Welt, in der "Situps machen" mit "Empowerment" gleichgesetzt wird...
Und was jetzt?
Jetzt stehen wir an einem Punkt, an dem es nicht um noch mehr Leistung geht.
Sondern um die Wahrheit hinter dem Ideal.
Und die lautet:
- "Freiheit" ohne tatsächliche Anerkennung und verbesserte System-Struktur ist keine Gleichberechtigung.
- "Gleichberechtigung" ohne Fürsorge ist Ausbeutung.
- Selbstverwirklichung ohne Systemkritik endet nicht selten im Selbstoptimierungswahn.
Solange wir Fürsorge nur dann fördern, wenn sie ins alte System passt, wird Supermom niemals frei – sie bekommt nur jedes Jahrzehnt ein neues Kostüm, so dass es niemand merkt.
Wenn Frauen das Gleiche dürfen wie Männer, aber trotzdem die ganze Fürsorge-Arbeit an ihnen hängen bleibt – dann ist das keine Gleichberechtigung.
Dann ist das eine neue Form der Überforderung und des Leistungsdrucks.
Auf den ersten Blick klingt Selbstverwirklichung großartig:
– Lebe deine Wahrheit.
– Finde deine Berufung.
– Werde die beste Version deiner selbst.
– Mach dein Ding!
Aber…
Das Problem ist nur, wenn du dabei ausblendest, in welchem System du dich selbst verwirklichst, dann wird aus Selbstverwirklichung schnell:
– mehr leisten,
– noch besser funktionieren,
– dich selbst ständig analysieren, regulieren, verbessern.
(Ganz besonders auch, wenn wir uns solo selbstständig machen. Oh weh... )
Und das ist der Knackpunkt:
Wenn du in einem System lebst, das:
– Frauen konstant überfordert,
– Care-Arbeit abwertet,
– Körper kontrolliert,
– Weiblichkeit nur sexualisiert und
– Überlastung individualisiert,
…dann kannst du dich noch so sehr "selbst verwirklichen“ – du wirst nie frei sein, solange du nicht "das System" mitdenkst.
Wenn du die ganze Zeit versuchst, dich selbst zu optimieren – aber nie fragst, ob das in dem System überhaupt geht oder für wen du das eigentlich machst – dann bist du nicht
frei.
Du bist im Hamsterrad mit Goldlack.
Wenn diese ganze "Coaching"-Welt, die Selbsthilfe-Industrie, der Achtsamkeits-Boom, die Diäindustrie nur bedeutet:
Mach dich besser – dann passt du schon irgendwie rein!
Dann ist das auch nur wieder genau die selbe innere Sklaverei.
🫶 Was brauchen Mütter stattdessen?
- Sichtbarkeit. "Erlaubnis" (wobei das natürlich völlig absurd ist). Empathie. Und echte Begleitung.
- Kein Leistungsanspruch, sondern ein sicherer Rahmen.
- Raum für Tränen, Zweifel und "Unvollkommenheit". Einfach so sein dürfen, wie man gerade ist.
- Keiner Norm entsprechen müssen, die es eh nicht gibt.
- Klare therapeutische Haltung: Du musst nichts leisten, um eine Lebensberechtigung zu haben.
- Sanftes Körperwissen statt Druck.
Und was wir eigentlich brauchen, ist eine nächste Emanzipations-Welle.
Eine, die nicht fragt:
Wie schaffe ich das alles besser, schneller, leichter?
Wie werde ich noch gleicher?
Sondern:
Warum muss ich das überhaupt schaffen?
Warum sollte ich das überhaupt schaffen?
Wozu?
Und: Wie kann ich wirklich ich selbst sein?
Die Supermom lebt weiter – nicht, weil wir sie brauchen, sondern weil das System sie braucht.
Die Supermom lebt so lange weiter, bis du es merkst.
Bis du keine Lust oder Kraft mehr hast, sie zu spielen.
Wir brauchen nicht nur einen Paradigma Wechsel, wir brauchen eine Beerdigung!
RIP Supermom
🖤 Lass uns bitte hier und jetzt die SuperMom™ begraben!
Zusammen mit der WonderWoman™.
Wir sind heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen… von einer Frau, die es nie gab – und die trotzdem in so vielen von uns gelebt hat.
Auf ihrem Grabstein steht:
🪦
Hier ruht das Ideal der Frau, die alles konnte – aber nichts fühlen durfte.
Sie wurde nie müde. Und nie wirklich gesehen.
Hier ruht das Ideal der perfekten Frau und Mutter, das uns glauben ließ, wir müssten alles sein – nur nicht wir selbst.
Wir lassen sie gehen – für etwas Wahrhaftigeres.
Von Kondolenzbekundungen bitten wir abzusehen.
Und nein, wir trauern nicht wirklich.
🗽 Was kannst DU jetzt tun?
- Dir immer wieder bewusst machen, wie "das System" wirklich läuft.
- Deine gesunde Reaktion auf ein ungesundes Ideal ist kein Versagen – sie ist ein Zeichen, dass du spürst, dass was nicht stimmt.
- Nicht du bist falsch!
- Achte und wahre deine Grenzen.
- Du musst dich nicht dem System anpassen.
- Überlege dir, aus welcher Motivation heraus du handelst, wenn du merkst, deine innere Stimme sagt dir was anderes.
- Du darfst! (Egal was). Dir Hilfe holen, Hilfe einfordern, Pausen machen, kein Bock haben, schlafen, heulen, konfrontieren.....
🎙️ Und was kannst du als Fachfrau tun?
Hier ein paar Impulse für deine Praxis:
- Frag nicht nur nach Zielen ("Was willst du wieder können?“, "Was wollen wir mit unserer Behandlung erreichen?"), sondern auch nach Zustand ("Wie geht’s dir wirklich?“, "Was kann ich dir Gutes tun?").
- Betone Pausen, Regeneration und liebevolle Körperwahrnehmung.
- Verschiebe den Fokus von "schnell wieder fit werden" auf "ich unterstütze so lange es dauert".
- Verlagere deine Sichtweise auf den gesamten Menschen, anstatt nur auf Rektudiastase oder Beckenboden nach der Geburt. Und das auch nicht nur rein körperlich, sondern tatsächlich ganzheitlich, Seele inbegriffen.
- Respektiere die tatsächliche Biologie und Physiologie von Frauen in der Schwangerschaft und nach der Geburt und erkläre sie deinen Patientinnen. (Du glaubst nicht, wie viele Beiträge ich bei Instagram geschickt bekomme, damit ich mal abchecke, ob irgendwas gut ist. Die Insta-Rückbildung lebt!!! Machen wir uns nichts vor. Das hat einen so massiven Einfluss. Ganz viele Frauen nehmen das als Wahrheit, wenn da steht "Übung gegen Rektusdiastase" und die Aerobic Jane Fonda 2025 erklärt dir wie's geht).
- Sag deinen Patientinen/Klientinnen ganz klar: "Wir dürfen den Druck rausnehmen.“ "Du darfst den Druck rausnehmen", "Es geht nicht darum, schneller zu funktionieren“, "Du darfst Hilfe annehmen – auch von mir.“
Die Supermom ist keine Superkraft – die Supermom bzw. die Vorstellung von der Supermom, ist eine Falle, die nicht selten in einem körperlichen und/oder seelischen Absturz endet früher oder später.
(Es sei denn du bist dir ganz genau bewusst, welche Automatismen in deinem Leben ablaufen und wie du sie stoppst, bevor es zu spät ist, sprich bevor du auf dem Zahnfleisch gehst).
Fazit: Paradigmenwechsel statt Selbstoptimierung
Dem Ideal der Supermom nicht zu entsprechen ist kein individuelles Versagen, sondern eine gesunde Reaktion auf ein ungesundes Ideal.
Es zu durchbrechen heißt nicht nur das eigene Verhalten zu ändern, sondern diese eingegrabenen Strukturen mitzudenken – und gemeinsam zu verändern.
Und vor allem: Dich nicht selbst fertig machen!
Auf gar keinen Fall.
Warum wir wachsam bleiben müssen
Das Muster von Fortschritt und dem dazu gehörigen Gegenwind ist so alt wie die Menschheit selbst.
Ein Schritt vorwärts und zwei zurück.
Rückschritte kommen selten mit wehenden Fahnen.
Sie schleichen sich ein – getarnt als "Rückkehr zu Werten“, "Stärkung der Familie“ oder "freie Entscheidung“, was leider nicht immer wirklich freie Wahl bedeutet.
Es wird so verkauft, als könnten Frauen (oder Eltern) ganz frei entscheiden, ob sie z. B. zu Hause bleiben oder arbeiten – in Wahrheit sind die Rahmenbedingungen oft so gestaltet, dass eine Option faktisch kaum möglich ist.
Auf dem Papier klingt das alles oft harmlos oder sogar positiv. In der Realität bedeuten solche Maßnahmen jedoch: Weniger Wahlfreiheit, weniger Absicherung, mehr Belastung – und eine schleichende Rückkehr zu alten Rollenmustern.
Heute sehen wir das an vielen Stellen: Unzureichende Kinderbetreuung, steuerliche Anreize fürs Zu-Hause-Bleiben, ein Gesundheitssystem, das Mütter nach der Geburt immer schneller aus der Versorgung entlässt. Selbst in der feministischen Debatte gibt es Strömungen, die Care-Arbeit wieder romantisieren, ohne die strukturelle Abhängigkeit dahinter zu hinterfragen.
Die Geschichte zeigt:
Fortschritt ist nie selbstverständlich. Wer glaubt, dass Gleichberechtigung ein fest verankerter Zustand ist, übersieht, wie schnell Rechte wieder ausgehöhlt werden können (siehe USA. Und klar ist das nicht hier bei uns, aber schnell kann's gehen. Siehe unser Wahlergebnis 2025).
Wir müssen Strömungen erkennen, bevor sie Gesetz werden. Und wir müssen laut bleiben – gerade in einer Zeit, in der viele Mütter vor Erschöpfung gar nicht mehr die Kraft haben, politisch zu kämpfen.
Das ist vielleicht der perfideste Mechanismus von allen:
Wer am Limit ist, hat keine Energie für Revolution.
Wir haben jetzt natürlich keine Revolution im Sinn.
Aber, es ist wichtig, aufzupassen und wach zu bleiben.
Ich will damit sagen, genau deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gut um die Mütter kümmern.
Nicht, damit sie fit bleiben oder werden, um (noch) mehr leisten zu können, sondern um mehr und vor allem sie selbst sein zu können!
Und damit wir alle unsere Rechte wahren können auch die unserer Kinder in der Zukunft.
Wir brauchen dringend ein System, dass Frauen ganz natürlich in ihrem Sein unterstützt, nicht in ihrer "Rolle". Ohne, dass das für irgendwelche Ideologien mißbraucht wird. Das ist doch der Hammer, dass das überhaupt so benutzt wird. Frauen als Instrumentalisierungsobjekt, als ob sie immer noch eigenständig nichts zählen.
Politik wird von Männer gemacht hauptsächlich. Kriege werden von Männern geführt.
Unsere Aufgabe ist es, finde ich, als Therapeutinnen, Räume zu schaffen, in denen Frauen sich wirklich erholen und regenerieren können. Wo sie eben nicht angetrieben werden zu mehr Leistung.
Echte Fürsorge, echte Care-Arbeit FÜR Frauen ist kein "Luxus“ und kein ideologisches Spielfeld.
Sie ist die Grundlage für unsere Gesellschaft, die eine gesunde Zukunft überhaupt möglich macht.
Wenn mehr Frauen gut versorgt werden würden, würde es mit Sicherheit weniger Massenmörder und Psychopathen auf der Welt geben.

Hi, ich bin die Nicole. Ich bin seit über 25 Jahren Physiotherapeutin und habe viele Jahre auf der Wochenstation und auf der gynäkologischen Station in der Frauenklinik gearbeitet. Von mir bekommst Du Informationen zum "Thema" aus erster Hand.
Rückbildung vom ersten Tag an, im Rückbildungskurs, in der Praxis mit Patienten und leider auch oft die Spätfolgen von Beckenbodenschwächen (und was es sonst noch alles geben kann) in der operativen Gynäkologie, kenne ich in und auswendig.
Bei mir bist Du richtig, wenn Du reale medizinische Informationen zum Thema
Rückbildung und Frauengesundheit suchst. Mehr über mich findest Du hier.

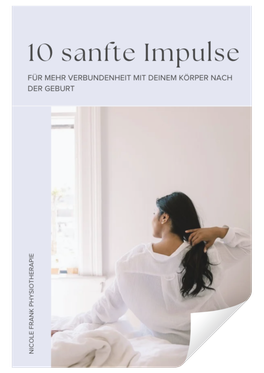

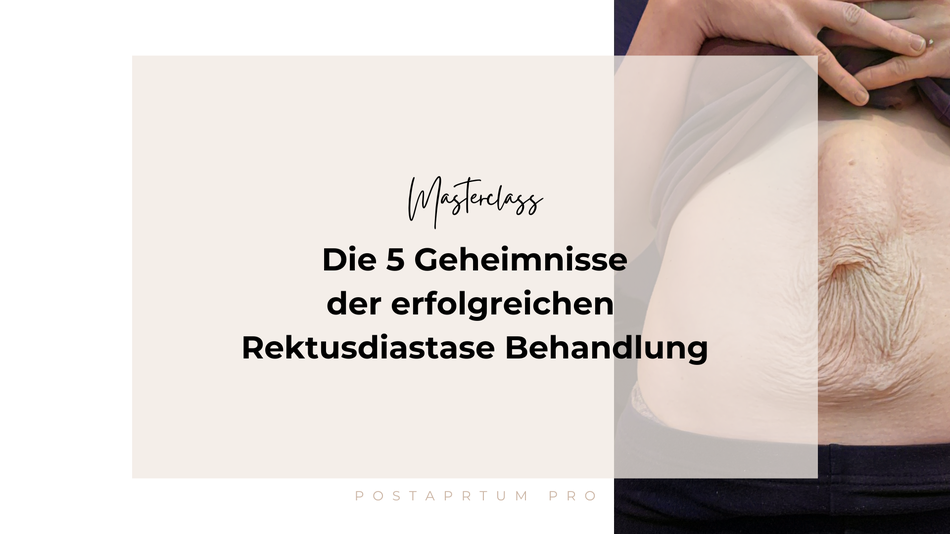




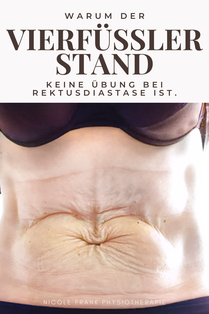
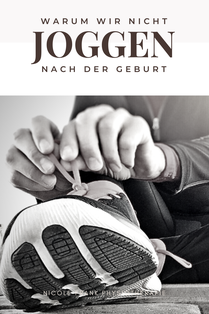

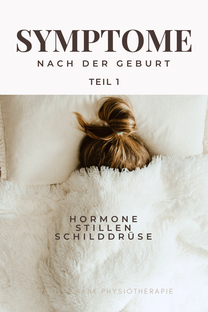





Kommentar schreiben